 |
|
| Druckversion |
|
|
| Vorabdruck aus Rolf Arnold: Seit wann haben Sie das? Grundlinien eines emotionalen Konstruktivismus |
||||
|
||||
| Kapitel 5: Lesarten zur Wirkung des Emotionalen Über die Auswirkungen unserer emotionalen Festlegungen wurde schon früh nachgedacht – mit unterschiedlicher Radikalität und Konsequenz. Und bisweilen finden sich dabei auch Einsichten und Fragen aufgeworfen, die geeignet sind, als Vorläufer eines Emotionalen Konstruktivismus angesehen zu werden. Dies ist auch anderen aufgefallen. So ist zu erklären, dass der Hirnforscher Damasio die Überlegungen von Spinoza neu entdeckt. Vergleichsweise hilflos wirken demgegenüber pädagogische Argumentationen, die an der alten Vernunfthoffnung festhalten – vielleicht, weil sie nicht daran glauben (können), dass auch und gerade ein Verständnis der Wirkungsmechanismen des Emotionalen uns heute auch wirksame Wege eines Andersseins und einer Umdeutung zu eröffnen vermögen, auch wenn diese schwierig anmuten. Doch ist es gerade diese Pragmatik des Andersseins, welche ohne das intentionale Um- und Neufühlen nicht wirklich gelingen kann: Wir müssen Gelegenheiten erhalten, mich anders zu fühlen, um mich dann auch neu erfinden, ausprobieren und erzählen zu können – so die grundlegende These einer Transformativen Pädagogik. In diesem Sinne greift auch die bekannte Formulierung eines Epiktets, es sei das Denken über die Dinge, nicht die Dinge selbst, die den Menschen beunruhigen, zu kurz. Es ist das Denken und Erleben der Kontexte, welche uns zu beunruhigen vermögen – eine Weiterung, die in den systemischen Konzepten eines Paul Watzlawick zum „Andersein“ bloß vorbereitet, aber noch nicht ausgearbeitet wurden. Für Watzlawick sind es die „Weltbilder“ (vgl. Watzlawick 1991, 36ff), nicht das „Welt(er)fühlen“, welches uns zu beunruhigen vermag. Letzteren Aspekt greift der Emotionale Konstruktivismus auf und präzisiert diesen in Richtung der Pragmatik einer Transformativen Bildungstheorie, für welche die Schritte des veränderten, erneuerten und erneuten Sich-in-der-Welt-Fühlens sowohl erkenntnis- als auch handlungstheoretisch grundlegend sind. Der „Spinoza-Effekt“ von Antonio R. Damasio Der Hirnforscher Antonio R. Damasio, Leiter des Departments für Neurology an der University of Iowa, stellt in seinem Buch „Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen“ (Damasio 2005) die Ergebnisse seiner Forschungen in den Kontext der Arbeiten des Frühaufklärers Spinoza. Dabei wird deutlich, dass bereits dieser Philosoph des 17. Jahrhunderts vieles von dem vorwegnahm, was uns die neurobiologische Forschung heute eindrucksvoll zeigt. Dies gilt insbesondere für das Zusammenwirken von Gefühl und Verstand bzw. von Emotion und Kognition. Selbst die rationalsten Entscheidungen werden – wie Spinoza bereits wusste – durch unsere letztlich körperlichen Gefühlsbewegungen vorbereitet, ausgelöst, mitbestimmt und gesteuert. Wir suchen dann gewissermaßen eine zu dieser Emotion passende äußere Ursache, welche uns als auslösendes Objekt des emergierenden emotionalen Zustandes zu dienen vermag Damasio liefert in seiner Auseinandersetzung mit Spinaza gewissermaßen en passant auch einige definitorische Klarstellungen, die uns helfen, uns auch „im Gefühlsdschungel“ (Stavemann 2001), der zunächst auch eine Begriffsdschungel ist, zu orientieren. Für Damasio „(treten) die Emotionen auf der Bühne des Körpers auf, die Gefühle auf der Bühne des Geistes“ (Damasio 2005, S.38). Dies bedeutet, dass sich im Bereich unserer affektiven Bezogenheit offensichtlich Körperliches und Denkerisches schier unentwirrbar vermischen. Es ist die Emotion, die als „Teil der automatischen und grundlegenden Mechanismen der Steuerung unseres Lebens“ (ebd., S.38) wirkt und den Gefühlen „vorausgehen“, wie Damasio sagt. Für ihn sind „(…) weit eher die Gefühle die Schatten der äußeren Manifestationen von Emotionen“ (ebd., S.40). Bei den Emotionen handelt es sich um „(…) einfache Reaktionen, die auf simple Art und Weise für das Überleben eines Organismus sorgen und sich daher in der Evolution leicht durchsetzen konnten“ (ebd.). Emotionen sind so gesehen die grundlegenden Stellungnahmen des Menschen zur Welt, sie sind „das Ergebnis einer Situationseinschätzung durch den Organismus“ (ebd., S.69). In ihnen ist Ausdrucks- und Bewegungsweise des Menschen tief eingespurt. Damasio spricht von einer „automatischen Steuerung von Lebensprozessen“ (ebd., S.45). Dabei geht es dem einzelnen Menschen zunächst um Selbsterhaltung, d.h. um eine Balance zwischen dem Sich-in-der-Welt-Fühlen und den tatsächlichen Bedingungen des In-der-Welt-Seins. Der übergeordnete Zweck, dem das Ganze dient, ist das Überleben „in einem Zustand des Wohlbefindens“ (ebd., S.49), wobei auch Damasio weiß, dass es sich bei diesem Zustand um eine subjektive Konstruktion der Wirklichkeit handelt. Diese ist letztlich körperlicher Art und Überbleibsel der Evolution. Dereinst sicherten sie das Überleben, während sie sich in den heutigen Lagen der Menschen als hinderlich erweisen können, weshalb wir – wie Damasio sagt – uns ständig überlegen sollten, „wie wir sie entweder unterdrücken oder wie wir unsere Reaktionen auf ihre Ratschläge entschärfen können“ (ebd., S.52). Dies ist für ihn eines „der wichtigsten Ziele unserer Erziehung“ (ebd., S.69), der es darum zu gehen habe zu lernen, „zwischen Auslöser und emotionaler Reaktion einen nicht-automatischen Schritt zu setzen“ (ebd.). Emotionale Kompetenz ist die Fähigkeit, den Automatismus zwischen Auslöser und emotionaler Reaktion möglichst dauerhaft zu unterbrechen bzw. zumindest in den Ausdrucksformen, zu denen er uns führt, zu entschärfen. Der „Spinoza-Effekt“, von welchem Damasio spricht, ist nun darin zu sehen, dass in dessen Sichtweise zum Zusammenwirken von Geist und Natur gewissermaßen eine Vorwegnahme der Einsichten der neueren Hirn- und Emotionsforschung gesehen werden kann. Für Damasio ist Spinoza „ein Vorläufer des modernen biologischen Denkens“ (ebd., S. 300), wobei nicht recht deutlich wird, ob es bereits dieser Sachverhalt ist, welche ihn vom „Spinoza-Effekt“ sprechen lässt. Vieles spricht dafür, dass es die Zähigkeit und der Mut sind, welche Damasio im Blick hat: „Spinoza hatte nicht von Natur aus ein heiteres Gemüt, sondern war zäh und mutig. Er rang um Heiterkeit“ (ebd., S.324) – eine Haltung, welche Damasio nach seinen Einblicken in die emotionalen Grundlagen des menschlichen Seins wohl auch sich selbst und anderen ins Stammbuch zu schreiben gedenkt. Es geht dabei – wie auch bei William James (1884) – um die Wahrung einer inneren Balance als eine subjektive Leistung – „eine individuelle und innerliche Aufgabe, etwas, was sich dadurch erreichen lässt, dass man durch geeignetes Denken die richtigen Emotionen und Gefühle erzeugt“ (ebd., S.325) bzw. zu erzeugen lernt. Dies ist für Damasio selbst allerdings bloß die Basis, von welcher er seine eigene – über Spinoza hinausweisende „Moral von der Geschichte“ (gewissermaßen: den Damasio-Effekt) entwickelt, indem er „eine etwas aktivere Haltung gegenüber der uns umgebenden Welt“ (ebd., S.326) einnimmt und zugleich nachdrücklich darauf verweist, dass das sich differenzierende Wissen über die Funktionsmechanismen des menschlichen Geistes uns neue Wege zu weisen vermag, um „positive Emotionen hervorzurufen, wo sich sonst negative Emotionen ausbreiten könnten“ (ebd., S.328): „Das Wissen um Emotionen, Gefühle und ihr Wirken ist von Bedeutung für die Art und Weise, wie wir leben. Auf der persönlichen Ebene ist das bereits hinreichend bekannt. Im Laufe der nächsten zwanzig Jahre, vielleicht schon früher, wird die Neurobiologie der Emotionen und Gefühle der Biomedizin ermöglichen, wirksame Behandlungsmethoden für Leid und Depression zu entwickeln. Die neuen Verfahren werden darauf ausgerichtet sein, spezielle Beeinträchtigungen eines normalen Prozesses zu korrigieren, statt global gegen die Symptome vorzugehen. In Verbindung mit psychologischen Therapien werden die neuen Behandlungsmethoden die Psychiatrie vollkommen umkrempeln. Die Therapieformen, die uns heute zur Verfügung stehen, werden uns dann so roh und archaisch erscheinen wie heute die Chirurgie ohne Anästhesie“ (ebd., S.331). Hiermit artikuliert Damasio eine umfassende technologische Hoffnung, die bislang allerdings noch wenig Berechtigung hat und auch sehr unanstrengend und leicht erreichbar klingt. Demgegenüber ist der Weg der Spiritualität, wie er bei Spinoza, James und anderen anklingt, sehr viel anstrengender, denn er setzt das suchende, lernende und übende Bemühen um eine innere Haltung voraus, die sich nicht quasiautomatisch aus den Funktionsmechanismen unseres Geistes ergibt. Es gilt vielmehr das tägliche Selbst-Niederringen zu lernen und zu üben – ein Effekt, welcher bei den angedeuteten biochemischen Lösungen wegfällt, weshalb man mit diesen auch in der Gefahr steht, die erforderliche Lösung genau durch die gewählte Behandlungsstrategie zu verfehlen und nicht an den inneren Punkt zu gelangen, welchen auch Damasio in seiner Bedeutung für eine emotionale Kompetenzentwicklung deutlich erkennt: „Wenn Gefühle (…) Indizien für den Zustand des Lebensprozesses sind, legen spirituelle Gefühle von etwas Tieferem Zeugnis ab, graben sie tiefer in die Substanz des Lebendigen. Sie bilden die Grundlage für die intuitive Erfassung des Lebensprozesses“ (ebd., S.327). Damasio und Spinoza geht es gleichermaßen um eine Bestimmung des Verhältnisses des Menschen zur Natur. Beide sind darum bemüht, auf der Basis der zu ihrer Zeit jeweils vorliegenden Erkenntnisse ein realistisches Bild dieses Verhältnisses zu zeichnen. Dabei rückt bei beiden die Frage nach dem Verhältnis zwischen den emotionalen und den kognitiven Konstruktionen unserer Wirklichkeit in den Blick, wobei erstere mehr unwillkürlich und letztere eher willkürlich zu Werke zu gehen scheinen. Doch beide Autoren, Spinoza und Damasio streben eine emotionale Kompetenz an, welche den einzelnen in die Lage versetzt, mit seinen emotionalen Konstruktionen der Wirklichkeit in einer Weise umzugehen, welche ihnen eine Vielfalt ermöglicht, die ihre bisherige Rekonstellierungspraxis aufzuweichen vermag: Die Vernunft kann ohne Gefühl nicht wahrnehmen, denken, unterscheiden und entscheiden, doch trüben die emotionalen Gewissheiten immer wieder unsere Eindrücke. Um zu tragfähigen und – den jeweils wechselnden Lagen – angepassten Deutungen und Verhaltensweisen zu gelangen, bedarf es eines Verständnisses der Wirkungsweisen unserer emotionalen Konstruktion der Wirklichkeit. Um dieses Verständnis haben sich in der pädagogischen Forschung und Theoriebildung zahlreiche Theorien bemüht. Folgt man den Arbeiten von Ilse Bürmann (1997; 2008), so stellen die Gefühle in der Pädagogik deshalb keineswegs eine vergessene oder gar „verborgene“ (Buddrus 1992) Thematik dar. Bürmann verweist auf die die Beiträge der pädagogischen Anthropologie (u.a. Böhme 1997; Böhme/ Böhme 1992), mit ihren bisweilen auch zivilisationskritischen Anmerkungen (Rumpf 1988) sowie die umfangreichen Arbeiten der Humanistischen Pädagogik. Beiden ging es um eine ganzheitlicher Sicht des Menschen mit seinen kognitiven und emotionalen Bewegungen und Gebundenheiten. Auch die neueren Ansätze einer systemischen Pädagogik (vgl. Arnold/ Arnold-Haecky 2009) gehen in diesem Sinne davon aus, dass die eigenen Emotionen, in denen Eigenes und Vergangenes einer Person seinen Ausdruck findet, zugleich „eine beziehungsgestaltende Fähigkeit“ beinhaltet und somit eine für die Pädagogik wirkungsvolle Dimension berührt, wie Daniela Heisig (2008, S.50) schreibt: „Emotionen können Beziehungen regulieren, sie übernehmen die Gestaltung bedeutsamer Beziehungen. Sie >gehören< allen Beteiligten, da sich in Systemen zwischen Menschen ein unbewusstes dynamisches Beziehungssystem bildet, in dem die Mitglieder im System stellvertretende Positionen und Gefühle der anderen einnehmen bzw. ausdrücken (können)“ (…) In all diesen und anderen Modellen wird deutlich, dass die übliche Erfahrung des isolierten Einzelwesens schon längst überwunden sein müsste. Es ist deutlich geworden: Die >emotional-energetischen Felder< wirken in unseren Beziehungen“ (ebd.). Damit verliert das Emotionale seine intraindividuelle Eingrenzung und wird zu einem interindividuellen – systemischen – Geschehen . Blickt man in dieser Weise auf die Persönlichkeitsentwicklung und das Lernen von Menschen, so entindividualisieren sich die Betrachtung und der Gegenstand: Menschen und ihre Emotionen werden als Ausdruck der Systeme, in denen sie stehen oder denen sie entstammen, gesehen, und vieles, was uns im Verhalten des Gegenübers problematisch erscheint, stellt sich uns neu als Ausdruck „fehlender emotionaler und spiritueller Verbundenheit“ (Heisig 2008, S.53) dar. Mit solchen Überlegungen erweitert der Emotionale Konstruktivismus seinen Blickwinkel und liefert wesentliche Anregungen für eine Theorie des Sozialen. Das Soziale war noch nie allein identisch mit den uns nüchtern gegenübertretenden Möglichkeiten und Zumutungen von Lebenswelt und Gesellschaft, es war stets auch die Gesamtheit des in uns wirkenden Gefühls der Zugehörigkeit, Beziehungsgestaltung und Anerkennung. Diese Gefühle drücken das Interesse des Einzelnen am Anderen aus und leiten seine Orientierungen sowie seine Formen der Lebensgestaltung. Wir inszenieren uns niemals nur vor uns selbst, sondern stets im Blick auf die soziale Resonanz. Und umgekehrt liefert uns das Soziale das Material, mit welchem wir uns in unserem Denken, Fühlen und Handeln auf die Anderen beziehen und aus dieser Bezogenheit unsere soziale Identität jeweils neu bestimmen. Auch die soziale Identität ist ein Emotionsraum, der uns Plausibilität und Gewissheit zu stiften vermag. Durch subtile Mechanismen der Prägung durch erlebte oder erzählte Vorbilder, emotionale „Treueschwüre“ sowie Bindungserleben halten wir soziale Muster des Denkens, Fühlens und Handelns lebendig, und nicht selten hat man den Eindruck, dass „das Leben unserer Vorfahren in uns wiederkehrt“ (Schützenberger 2005). Auf diesem Wege entstehen die familientypischen Gemeinsamkeiten im Erscheinen und im Auftreten, und es spricht viel dafür, dass dabei Mechanismen einer intergenerationalen Sozialisation wirksam werden, welche den biographischen Kokon, in dem sich unsere Vorstellungen vom individuellen Leben entfalten, in Frage stellen. Unser Leben scheint nicht nur unsere Angelegenheit zu sein, in ihm scheinen vielmehr auch Kräfte zur Wirkung zu gelangen, die weit zurückreichen. In diesem Sinne beleuchtet die Französin Anne Ancelin Schützenberger in ihren Studien Phänomene der „unsichtbaren Familienloyalität“ oder des sogenannten „Jahrestagssyndroms“, in denen persönlich Erlebtes deutliche Parallelen zur vergangenen Geschichte des eigenen Familiensystems aufweist. Für sie spricht viel dafür, „(…) dass wir gebunden und verstrickt sind in Ereignisse, die oft viele Generationen zurückliegen. Schwere seelische und körperliche Belastungen, Unfälle, Scheitern in Liebes- und Arbeitsbeziehungen, all das kann aus einer unbewussten Verbindung mit unseren Vorfahren herrühren, deren Leben und Schicksal in uns weiterwirkt“ (ebd., S.11). Diese These von der inter- oder transgenerationalen Prägewirkung erscheint in vielem plausibel und evident, sie ist im Einzelnen empirisch jedoch schwer belegbar. Der Verweis auf das aus der Vergangenheit Wirkende kann im konkreten Fall entlastend und auch klärend sein, doch aus diesem Wirken eine Erweiterung unseres theoretischen Verständnisses der emotionalen Konstruktion der Wirklichkeit abzuleiten, bedarf weiterer Erläuterungen. Dabei scheint der Sprachgebrauch im Kontakt mit den noch lebenden Vorfahren eine große Rolle zu spielen, doch auch ihre Weisen des Gefühlsausdrucks und der Lebendigkeit oder Unlebendigkeit. Die Sprache teilt nicht nur mit, sie verschweigt auch und tabuisiert. Und auch die Worte, mit denen ein vergangenes Ereignis immer und immer wieder geschildert, die Auslassungen oder gar das Verschweigen, welches dabei eine Rolle spielt, stellen das Sozialisationsbad unserer frühen Einspuren und Prägungen dar. Um im Bild zu bleiben, könnte man sagen, dass das Wasser dieses Bades älter ist als wir selbst. In ihm spüren oder entbehren wir die Freude und Lebendigkeit der Welt, indem wir in die Augen unserer Eltern blicken, tanken wir ihre Traurigkeit, ihr Versagen und ihren Erfolg, und wir spüren in ihm auch die fortwirkenden Erschütterungen vergangener Bedrohungen oder versunkener Hoffnungen. Möglicherweise wirken die Erinnerungen eines genetischen Gedächtnisses und designen aus dem Hintergrund heraus die Muster des uns Möglichen und Erträglichen. Und alle diese Kräfte wirken hinein in unser Reagieren, Stellung nehmen, Anblicken, Wegblicken, Hoffen und Gestalten. Indem wir auf Andere zugehen, tun wir dies offensichtlich auch in Teilen, so, wie unsere Vorfahren dies taten: zögernd, vertrauend, meidend oder aggressiv. Auch wenn diese Kräfte sich einer klaren empirischen Erfassung noch entziehen, die Fälle und Beschreibungen, in denen sie deutlich erkennbar sind, legen nahe, unsere Vorstellungen vom selbst gelebten Leben zumindest zu ergänzen. Auch die sozialwissenschaftlichen Theorien von Ich und Ichentwicklung müssen ihre Kokon-Bilder hinterfragen und sich mit dem Sachverhalt zu beschäftigen beginnen, „(…) dass weitreichende Systemkräfte über Zeit- und Raumgrenzen hinaus Feldwirkungen entfalten, deren Ausmaß wir erst zu ahnen beginnen, deren Kenntnis und bewusste Verwendung aber wichtige Veränderungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen anstoßen können“ (ebd., S.14). Zur Frage der Veränderbarkeit von sich selbst und anderen Die neuere Hirnforschung hat im letzten Jahrzehnt zahlreiche Hinweise zu der Frage erarbeitet, wie das menschliche Denken, Fühlen und Handeln im Kontext kognitiver und emotionaler Systemiken entsteht. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Arbeiten von Gerhard Roth, dessen Überlegungen sich auch und gerade für den pädagogischen Diskurs als anregend und weiterführend erwiesen haben. In seinem Buch „Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten“ mit dem Untertitel „Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern“ (Roth 2007) spürt Gerhard Roth der Frage nach, ob und inwieweit unsere überlieferten pädagogischen Vorstellungen von der Veränderbarkeit des Verhaltens durch Lernen überhaupt empirisch haltbar sind. „Wie veränderbar ist der Mensch?“ fragt er und lotet die Verfestigung der menschlichen Biographie aus. Dabei zeigt sich, dass es neben den recht stabilen Elementen der Persönlichkeit (z.B. Intelligenz) auch eine ganze Reihe von Elementen gibt, die sich im Zeitverlauf unterschiedlich ausprägen. Während sich im psychomotorischen sowie im kognitiven Bereich bei geübten Menschen durchaus auch im Erwachsenenalter Lerneffekte erzielen lassen, scheint dies beim emotionalen Lernen deutlich weniger der Fall zu sein: „Dieses Lernen setzt sehr früh ein, nämlich bereits vorgeburtlich, und erlebt seinen Höhepunkt in den ersten Lebensjahren nach der Geburt. Hierbei bilden sich Charakter und Persönlichkeit in ihrem Kern aus. Während der ersten Schulzeit stabilisiert sich diese Persönlichkeit zunehmend, gerät aber während der Pubertät noch einmal in Aufruhr und verfestigt sich zum Erwachsenenalter. Es ist sogar so, dass Erwachsenwerden ganz typisch mit dieser Stabilisierung der Persönlichkeit verbunden ist – man sagt, dass eine Person endlich >zu sich gefunden hat<“ (ebd., S.225). Gerhard Roth leitet aus seinen Befunden keinen Erziehungspessimismus ab, er verweist uns jedoch deutlich auf die Grenzen von Veränderung und Lernen im Lebenslauf. Diese Grenzen sind in der Vergangenheit zu stark übersehen worden, weshalb sich auch eine allgemeine Euphorie des Lebenslangen Lernens hat ausbreiten können. Demgegenüber lenkt Roth den Blick auf die „Affektlogik“ (Ciompi), denen die Verhaltensweisen sowie die Veränderungsmöglichkeiten der Menschen gleichermaßen verpflichtet sind. „Jemanden verändern zu wollen,“ – so Gerhard Roth – „setzt voraus, dass man sein Fühlen, Denken oder Handeln hinreichend versteht. Nur dann kann man >den Hebel richtig ansetzen<“ (ebd., S. 263) – eine zutreffende, wenn auch doch sehr allgemeine und etwas mechansitisch anmutende Einschätzung. Was heißt das konkret? Da die Bedeutung jeglicher Information, Aufforderung oder Ermahnung nur vom aufnehmenden System erzeugt wird, geht es bei einer Veränderungsarbeit demnach zunächst stets darum, „die tief liegenden Gründe des Verhaltens“ (ebd., S.274f) des Gegenübers zu erfassen, was nach Roth soviel bedeutet, wie zu „(…) indentifizieren, was die Person in ihrem unbewussten Selbst antreibt“ (ebd., S. 275). Das Gelingen von Veränderungen hängt demnach vom Gelingen des Verstehens ab. Dies gilt auch für die Selbstveränderung. Man muss sich selbst verstehen, um sich verändern zu können. Auch dies ist schwierig. Zu erdrückend sind die Bestrebungen des eigenen Ichs, die eingeübten Ich-Zustände beibehalten zu dürfen. Gerhard Roth zeichnet diesen in unser emotionales System gewissermaßen eingebauten Rationalisierungszwang (1) detailliert nach: „Unser unbewusstes Selbst hat auf der Ebene des Bewusstseins für Plausibilität zu sorgen, deshalb werden Störungen korrigiert, indem Vorstellungen, Absichten und Wünsche so lange verändert und verbogen werden, bis sie ein rundes Bild ergeben – ein Bild, das uns ein subjektiv befriedigendes Fühlen und Handeln ermöglicht“ (ebd., S.285). Gerhard Roth analysiert detailliert die „Selbsttäuschungen besonderer Art“ (ebd., S.286ff), die bei dieser Realitätsbearbeitung im Spiele sind. Dabei handelt es sich um Mechanismen, die uns helfen, unerwartete und ungewünschte Ereignisse „weg-erklären“ (ebd., S.283) zu können, damit das „unbewusste Selbst“ (ebd.) – wie er es nennt – so bleiben darf, wie es will. Nach meinem Eindruck bezeichnet Gerhard Roth mit dieser treffenden Formulierung den emotionalen Kern der Identität, in welchem unsere Selbstbilder, Anerkennungsbedürfnisse, Ängste sowie Wirksamkeitserfahrungen gespeichert sind. Er spricht dabei auch vom „unbewussten emotionalen Selbst“ (ebd.), in welchem „das Kleinkind in uns“ (ebd.) gewissermaßen fortlebt und sich beständig darum bemüht, aus den aktuellen Anstrengungen und Gegebenheiten „diejenige Befriedigung (zu) saugen, die es für die Selbststabilisierung benötigt“ (2) (ebd.). Detailliert analysiert Roth die interpretativen Tricks, mit denen das Subjekt sich selbst und anderen Gegenüber diese Selbststabilisierung erzeugt. Dabei entstehen wie er schreibt – „wehmütige Autobiographien“ (ebd., S.284) oder gigantische Verschwörungserzählungen: „Man kann sich reinwaschen, weil man das Opfer finsterer oder starker Gegenkräfte war, und sich im Kampf dagegen neu aufbauen“ (ebd.). Pädagogisch nahe liegende Fragen sind in diesem Zusammenhang die Frage nach der Bewusstmachung oder gar Überwindung solcher unbewusst verankerten Rationalisierungszwänge sowie die Frage nach der Veränderbarkeit der „überwiegend binnengesteuert“ (ebd., S.290) denkend, fühlend und handelnden Menschen. Die Perspektiven, welche der Hirnforscher Gerhard Roth zu diesen Fragen entwickelt sind allerdings eher ernüchternd. So bestätigt er – fasst man seine Argumentationen zusammen – , dass Vertrauen der Stoff ist, aus dem sich die Veränderungsbereitschaft sowohl bei Führenden, als auch bei Geführten ergeben kann: „Glaubwürdigkeit wird sprichwörtlich >ausgestrahlt<, ebenso wie Unglaubwürdigkeit“ (ebd., S.298). Und es ist diese Vertrauensdimension, die Veränderung letztlich ermöglicht oder verhindert: „Wenn eine Person als Vorgesetzter oder auch als Privatmensch jemanden dazu bringen will, sein Verhalten so zu ändern, wie die Person es will, so ist dies vor allem anderen eine Frage der eigenen Vertrauenswürdigkeit“ (ebd., S.299). Hinzu tritt „das vorbildliche Verhalten“ (ebd.), mit welchem der Vorgesetzte sichtbar das ausdrückt, was ihm wichtig ist und wofür er steht. Dieser Ausdruck beeinflusst gewissermaßen die Chemie des Verhältnisses zu den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Können diese spüren, worauf sie sich da einlassen, fassen sie Vertrauen und sind oft auch bereit, bis an ihre Grenzen zu gehen. Vertrauen motiviert und setzt Kräfte frei – so ließen sich die von Gerhard Roth referierten Ergebnisse und Einsichten zusammenfassen. Es ist eine Pädagogik des Vertrauens und der Beziehungsgestaltung, die hier eine gewissermaßen zusätzliche Begründung aus hirnphysiologischer Perspektive erfährt, ohne dass die Hirnforschung uns wirklich zu neuen Einsichten oder Gewichtungen führt: „Vieles, was bisher aus Sicht der Neuro-Wissenschaften an Konsequenzen formuliert wurde, ist – auf den ersten Blick – so neu und originell nicht; viele methodische und didaktische Ansätze finden ihre Bestätigung durch die Neuro-Wissenschaften“ (Schirp 2003, S.315). Eine wichtige pädagogische Fragestellung ist die nach der Selbstveränderung. Diese sieht auch Gerhard Roth als den „Angelpunkt, an dem jede Veränderung durch andere ansetzen muss“ (Roth 2007, S.303). Denn auch das noch so motivierende Engagement einer Führungskraft kann nur gelingen, wenn diejenigen, auf die sich diese Bemühungen beziehen, auch selbst in irgendeiner Weise selbst veränderungsbereit und wandlungsfähig sind. Und diese Fähigkeit ist keineswegs schon allein deshalb automatisch gegeben, weil man versucht, sich selbst zu verändern. Diesen eigenen Willen durchkreuzt man selbst, und dies geschieht nicht durch bewusste Absicht, es ist vielmehr das eigene „unbewusste Selbst auf der unteren und mittleren limbischen Ebene“ (ebd., S.304), welches uns da einen Strich durch die Rechnung zu machen versucht, was ihm auch meist gelingt. Gerhard Roth zeichnet ein insgesamt eher skeptisches Bild über die Möglichkeiten einer Selbstveränderung in fortgeschrittenen Lebensphasen. Diese scheinen ihm nur in Ausnahmenfällen und fast durchweg nur im Kontext anderer mehr oder weniger tiefgreifender Lebensumstellungen wahrscheinlich zu sein, obgleich sie auch dann oft nur vorübergehender Art sind. Zu mächtig sind die hirnphysiologisch fundierten Kräfte der alten Gewohnheiten. Veränderung – so seine pessimistische Perspektive – findet nur statt, wenn sie Not tut, d.h. wenn das Subjekt keine Ausweichmöglichkeiten mehr hat oder verlockende Belohnungen in Aussicht stehen (z.B. Aufstieg, Geld). Auch durch „Selbstkonditionierung“ kann der einzelne allmählich in zunächst irrelevanten Kontexten andere Verhaltenweisen einüben, welche ihm dann auch zu einem anderen Auftritt in wichtigen Kontexten verhelfen können. Gerhard Roth markiert wichtige Mechanismen eines emotional sich wandelnden Umganges mit vertrauten Begrenzungen: „Das Grundprinzip besteht darin, emotionale Schwierigkeiten durch Automatisierung und Routinisierung zu beheben. Zu Beginn muss ich mir leuchtende Vorbilder wählen, mir ebenso leuchtende Ziele setzen, mir kleine Belohnungen für kleine Fortschritte ausdenken, um dann von diesen Starthilfen immer unabhängiger zu werden. (…) Man kann sich durchaus ändern, wenn man in seinen Ansprüchen bescheiden ist und es richtig macht. Man kann es lernen, seine Impulse und seine Ungeduld zu zügeln, sich selbst zu motivieren, Durstsstrecken zu überstehen, sich selbst zurückzunehmen, selbstgenügsam zu werden, aber auch mehr Ehrgeiz, mehr Ordnung, mehr Pünktlichkeit zu zeigen“ (ebd., S.313). Eine solche Selbstveränderung setzt einen distanzierten Umgang mit sich selbst voraus. Gleichzeitig scheint sich die Stabilität der Persönlichkeit beim Selbstveränderungslernen besonders nachdrücklich in den Weg zu stellen. „Ich will so bleiben, wie ich bin“ scheinen die starren Momente unseres Selbst den Lernanforderungen zuzurufen, worauf unsere gewachsenen synaptischen Verschaltungen im Chor raunen: „Du darfst!“. Es bedarf einer achtsamen und misstrauischen Selbstbeobachtung, d.h. eine spezifischen Denkhaltung, welche sich nicht dem Gedankensurfen überlässt und durch dieses in emotionale Konstruktionen der Wirklichkeit abgleitet, welche den Akteur zu einem mehr und mehr unangepassten Reagieren und Verhalten zu führen vermögen, denn: „In der Regel gebärden sich unsere Gedanken wie eine Horde wilder Affen auf einem Baum“ (Born 2009, S.8). Es gibt jedoch Selbst-Achtsamkeitsfragen, mit deren Hilfe man sich vor sich selbst verteidigen kann, wie sie u.a. Jeannine Born vorschlägt. Achtsamkeit ist somit praktische Selbstverteidigung: ein Sich-Verteidigen vor sich selbst. Selbstachtsamkeits-Fragen ⁃ „Will ich den Angriff persönlich nehmen? ⁃ Will ich sofort eingreifen (etwas sagen) oder später? ⁃ Welches alternative Verhalten gibt es, das nützlicher ist als Kampf („dir zeig ich´s“) oder Flucht (beleidigter Rückzug und Faust im Sack)? ⁃ Welches Führungsinstrument eignet sich für diese Situation? ⁃ Dient das geplante Handeln meinen Zielen?“ Anmerkungen: (1) "Wir sind" - so Gerhard Roth im Anschluss an Michael Gazzaniga (1995) - "als bewusste Wesen (…) die letzten, die mitkriegen, was mit uns los ist und uns treibt; wir sind wie Regierungssprecher, die Dinge rechtfertigen müssen, die sie gar nicht veranlasst oder getan haben" (Roth 2007, S. 289) (2) Gerhard Roth weist auch darauf hin, dass dieses emotionale Selbst besonders bei narzisstisch gestörten Persönlichkeiten besonders unkontrolliert am Wirken ist: „In der Regel“ – so stellt er fest – „drängen nur Menschen mit einem narzisstischen Selbst nach Macht und Ruhm, während Menschen mit einem in sich ruhenden Selbst sich höchstens zu bestimmten herausragenden Positionen drängen lassen und diese bereitwillig wieder aufgeben. Sie unterscheiden sich relativ verlässlich von Ersteren dadurch, dass sie anschließend keine Autobiographien schreiben oder pausenlos in Talk-Shows auftreten, sondern sich dem widmen, was ihnen wirklich Spaß macht oder was von ihnen erwartet wird“ (Roth 2007, S. 284). Literatur: Arnold, R./ Arnold-Haecky, B. (2009): Der Eid des Sisyphos. Eine Einführung in die Systemische Pädagogik. Baltmannsweiler (Schneider). Böhme, H. (1997): Gefühl. In: Wulff, C. (Hrsg.): Vom Menschen, Handbuch Historische Anthropologie. Weinheim/ Basel (Beltz) Böhme, H./ Böhme, G. (1992): Das Andere der Vernunft. Studien zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants. Frankfurt (Suhrkamp), 2. Auflage. Born, J. (2009): Achtsamkeit in der (Selbst-)Führung. Lernende Organisation. Zeitschrift für Systemisches Management, 47: 6-12. Buddrus, V. (Hrsg.) (1992): Die „verborgenen“ Gefühle in der Pädagogik. Impulse und Beispiele aus der Humanistischen Pädagogik zur Wiederbelebung der Gefühle. Baltmannsweiler (Schneider). Bürmann, I. (1997): Überwindung des Dualismus von Person und Sache. Annäherungen an bildendes Lehren und Lernen. Bad Heilbrunn (Klinkhardt). Bürmann, I. (2008): Bildung und Gefühl. Reflexionen zu Grundlagen pädagogischen Handelns. In: Arnold, R./ Holzapfel, G. (Hrsg.): Emotionen und Lernen: Die vergessenen Gefühle in der (Erwachsenen-)Pädagogik. Baltmannsweiler (Schneider). Damasio, A.R. (2005): Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen. Berlin (List). Heisig, D. (2008): Wie wirklich sind Emotionen? In: Arnold, R./ Holzapfel, G. (Hrsg.): Emotionen und Lernen: Die vergessenen Gefühle in der (Erwachsenen-)Pädagogik. Baltmannsweiler (Schneider). Gazzaniga, M.S. (1995): Cosciousness and the cerebral hemispheres. In: Gazzanig, M.S. u.a. (Hrsg.): The new Cognitive Neurosciences. 2. Auflage. Cambrigde, S.1391-1400. Roth, G. (2007): Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Stuttgart (Klett-Cotta). Schirp, H. (2003): Neurowissenschaft und Lernen. Was können neurobiologische Forschungsergebnisse zur Unterrichtsgestaltung beitragen? Die Deutsche Schule, 95 (3): 304-316. Schützenberger, A.A (2005).: Oh, meine Ahnen! Wie das Leben unserer Vorfahren in uns wiederkehrt. Heidelberg (Carl-Auer), 4. Auflage. Stavemann, H.H. (2001): Im Gefühlsdschungel. Emotionale Krisen verstehen und bewältigen. Weinheim (Beltz). Watzlawick, P. (1991): Die Möglichkeit des Andersseins. Zur Technik der therapeutischen Kommunikation. Bern u.a. (Hans Huber), 4. Auflage. ---------------------------------------------------------------------------------------------- mit freundlicher Genehmigung des Carl-Auer-Verlages |
||||
|
|||||
|
Besuche seit dem 27.1.2005: 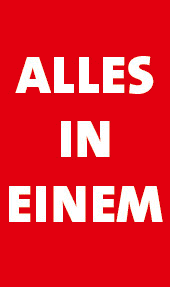  |

