 |
|
| Druckversion |
|
|
| Neuvorstellung | zur Übersicht | |||
|
24.11.2008 Sigrid Haselmann: Psychosoziale Arbeit in der Psychiatrie - systemisch oder subjektorientiert? Ein Lehrbuch |
||||
|
||||
|
Vandenhoeck & Ruprecht
Anja Boltin, Saarbrücken: Ein erster Blick auf das Cover und ich bin ein bisschen verunsichert: was ist das?! Übereinander gestapelte Bücher? Bunte Kreidestückchen? Seltsame Dachziegel? Mir fällt ein, worum es in diesem Buch gehen wird und ich muss unwillkürlich schmunzeln. Ich bin zwar noch immer nicht sicher, was dieses Bild nun wirklich darstellt, aber diese – beabsichtigte oder unbeabsichtigte – Verunsicherung meiner Wahrnehmungsgewohnheiten ist eine gute Hinleitung zum Thema. Das passt, irgendwie. Es geht um Psychiatrie. Ich fange an zu lesen und irgendwo zwischen Vorwort, Einleitung und erstem Kapitel kommt mir der Gedanke, dass es sich hier um ein wohltuendes Buch handelt. Auch wenn ich bis dahin nur einen ersten Eindruck habe: sowohl das Mitdenken der ostdeutschen Psychiatriegeschichte als auch die von der Autorin gewählte Lösung im Sinne einer geschlechtergerechten Sprache sind erfreulich: weibliche und männliche Formen werden im gesamten Buch – ohne Systematik - abwechselnd verwendet. Das Lehrbuch für Studierende und Berufspraktiker von Sigrid Haselmann, Professorin für Psychologie an der Hochschule Neubrandenburg, stellt ausführlich und kompetent verschiedene Ansätze psychosozialer Arbeit in der Psychiatrie vor. Dabei geht es der Autorin allerdings nicht um die klassische Psychiatrie mit ihrem biologisch-medizinischen, in der Regel defizitorientierten Krankheitsverständnis. Es geht ihr auch nicht um den daraus abgeleiteten pharmakotherapeutischen Behandlungsansatz, der von den Betroffenen in erster Linie Krankheitseinsicht und Compliance erwartet um sie dann, grundsätzliche Akzeptanz der Spielregeln vorausgesetzt, in die manchmal erdrückend starken Arme sozialer Fürsorge und Kontrolle zu nehmen. Diesen Teil der Psychiatrie lässt die Autorin links liegen. Stattdessen beschäftigt sie sich mit vorhandenen Alternativen und Gegenentwürfen und legt dabei den Schwerpunkt auf die Arbeit mit Psychoseerfahrenen. Im Herzstück des Buches, Kapitel zwei und drei, wird je eine Perspektive psychosozialer Arbeit detailliert beschrieben: das ist zum einen die subjektorientierte Sozialpsychiatrie, vielerorts gängige Praxis, zum anderen die systemische Perspektive, ein echter Hoffnungsträger der Branche. Es ist die Stärke dieses Buches, dass die beiden im Fokus stehenden Denkweisen klug und sehr differenziert gegeneinander abgewogen werden. Immer wieder werden verschiedene Sicht- und Herangehensweisen nebeneinander gestellt, miteinander verglichen und in ihren jeweiligen ziel- und kontextabhängigen Möglichkeiten und Grenzen beleuchtet. Es wird deutlich, dass die aus den beiden Ansätzen resultierenden Haltungen und Handlungsweisen recht verschieden sind und es daher dem einzelnen professionell Tätigen kaum möglich sein dürfte, beide Ansätze gleichzeitig zu realisieren. Die Autorin stellt sich und uns daher in einem abschließenden Kapitel die Frage, ob einer der beiden Perspektiven in der psychiatrisch-psychosozialen Praxis der Vorzug zu geben sei. Die Stärke des subjektorientierten Vorgehens sieht sie vor allem darin, dass die Betroffenen in ihrem Leiden und in den subjektiv sehr belastenden Krisen emotional verstanden und sinnstiftend begleitet werden können, während die systemischen Methoden vor allem in Entscheidungs- und Veränderungssituationen zu empfehlen sind, aber auch um drohende Chronifizierungen aufzuhalten oder schon erfolgte Chronifizierungsprozesse umzukehren. Sie plädiert insgesamt für eine sinnvolle Integration beider Arbeitsansätze und verweist diesbezüglich auf die erfreulicherweise auch hierzulande bekannter werdenden Modelle der Psychosentherapie skandinavischer Länder. Es werden sowohl die Chancen als auch Hemmnisse diskutiert, ein solches Modell bei uns umzusetzen sowie praktische Hinweise gegeben für eine idealtypische Integration der beiden Ansätze. Ich wünsche dem Buch, dass es viele verständige Leserinnen und Leser finden möge, die sich engagiert und kompetent, auch und gerade in den Nischen psychosozialer Arbeit, für die Belange der Betroffenen einsetzen – wenn möglich nicht allzu fürsorglich. (mit freundlicher Erlaubnis aus Psychosoziale Umschau 10/2008) Jürgen Leuther, Trochtelfingen: Solidarisch Mensch werden – auch in der Psychiatrie? Sigrid Haselmann hat ein hervorragendes Lehrbuch zur psychosozialen Arbeit in der Psychiatrie vorgelegt. Die Kombination von Einführung in das sozialpsychiatrische Arbeitsfeld, Vorstellung des subjektorientierten und systemischen Ansatzes und durchgängigen Reflexionen, was dies für die real existierende ost- und westdeutsche Praxis der Sozialpsychiatrie bedeutet, ist sehr gelungen. Im ersten Kapitel wird das Arbeitsfeld Soziale Psychiatrie im ideellen und strukturellen Kontext beleuchtet. Es ist sicherlich richtig, dass es auch sehr behandelnde, bevormundende Arbeitstile auch in einer sozialpsychiatrischen Tagesstätte geben kann und ebenso sehr emanzipatorische, Empowerment orientierte Arbeitstile in einer „normalen“ psychiatrischen Klinik. Aber nach meiner Erfahrung hat die Struktur einer Institution eben doch auch großen Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten. Eine Klinik mit einem biologisch orientierten Chefarzt wird sicherlich weniger Spielraum für einen systemisch-subjektorientierten Stil lassen, als ein Sozialpsychiatrischer Dienst mit einem Systemischen Therapeuten als Chef. Für mich als westdeutschen Mitarbeiter waren die Ausführungen zur Entwicklung der (Sozial-)Psychiatrie von den Zeiten der DDR zu den heutigen ostdeutschen Bundesländern neu und sehr interessant. Die genannten aktuellen Trends der Sozialpsychiatrie (Soteria, der gemeindepsychiatrische Verbund, der IBRP, Psychoseseminare, Selbsthilfe) werden zu Recht benannt, zeigen aber auch die großen Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung der Psychiatriereform. So wird z.B die flächendeckende Umsetzung des Soteria-Konzeptes so lange auf sich warten lassen, wie die Dominanz der biologisch-pharmazeutischen Psychiatrie anhält. Eine bundesweite integrierte Versorgung scheitert an den bürokratischen Hürden und den berufsständischen Besitzstandswahrungen und unnötigen Hierarchien und einer zu schwach ausgeprägten klinischen Sozialarbeit. Interessant ist die Diskussion zum schwierigen Thema „Hilfe und Fürsorge“ in der psychosozialen Arbeit. Die genaue Auftragsabklärung aus systemischer Sicht ist der erste wichtige Schritt um Klarheit zu gewinnen. Was aber, wenn aber ein Klient aufgrund seiner Sozialisation nicht genügend Ressourcen hat für sich zu sorgen oder seine Lebensbedingungen unmenschlich sind? Auf diese Fragen finden der systemische und der subjektorientierte Ansatz nicht genügend Antworten. Die subjektorientierte Sichtweise wird sicherlich bei ungenügenden Ressourcen des Klienten im Zweifelsfall eine fürsorgliche Haltung einnehmen und durch entsprechende Betreuungsangebote versuchen die Defizite auszugleichen. Die systemische Sichtweise würde bei ungenügenden Ressourcen irgendwann die psychologische Suche aufgeben und dieses Problem an ein für den Therapeuten nicht erreichbares Teilsystem der Gesellschaft verweisen. Unmenschliche Lebensbedingungen bekämpfen beide Ansätze nicht. Nur eine politisch akzentuierte psychosoziale Arbeit kann die Veränderungen der Lebensbedingungen ins Blickfeld nehmen. Der Ansatz von Staub-Bernasconi, der soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession sieht, bietet hierzu Antworten. Die Darstellung der subjektorientierten Sichtweise wird mit einer Einführung in die Handlungsfelder der Sozialpsychiatrie kombiniert und immer wieder schon quasi vorausblickend mit der systemischen Sichtweise konfrontiert. Diese Vermischung könnte vielleicht bei Anfängern zu Verwirrung führen. Da das Buch als Lehrbuch konzipiert ist, wäre hier vielleicht eine sauberere Trennung sinnvoll. Andererseits ist diese Vorgehensweise auch eine Stärke des Buches, da dies der Realität näher kommt. Ich habe mich beim Lesen immer wieder zustimmend nickend erlebt (Ja, dass kenne ich auch aus meiner Tätigkeit in der Sozialpsychiatrie, genau- das sind die Knackpunkte). Ein Beispiel dazu: Das Problem einer komplementär verstrickten Beziehung zwischen den Psychiatriebetroffenen, seiner Familie und den betreuenden Institutionen wird zurecht deutlich angesprochen und kann im bestehenden Psychiatriesystem von einer subjektorientierten Sichtweise nicht alleine aufgelöst werden. Ein systemischer Ansatz bringt hier frischen Wind in den chronifizierten Verlauf. Dieser wird aber häufig von der überwiegend nicht –systemisch arbeitenden Psychiatrie häufig wieder zunichte gemacht. Das 3. Kapitel „die systemische Perspektive“ ist das umfangreichste und bietet eine hervorragende Einführung in die Denk- und Handlungsmodelle dieser Richtung, insbesondere in die Besonderheiten der systemischen Sozialarbeit und der systemischen Psychiatrie. Die Nennung der Schwachstellen (z.B. fehlende Verstehensbegleitung, mangelnde Begegnung) erfolgen zu Recht und können hier sehr gut durch einen subjektorientierten Ansatz ausgeglichen werden. Beide Ansätze sind nötig, wenn ich den Psychiatrieerfahrenen gerecht werden und in diesem komplexen Arbeitsfeld professionell bestehen will. Die Kombination einer systemischen und einer subjektorientierten Arbeitsweise hat sich auch in meiner 19 jährigen praktischen Tätigkeit in einem Sozialpsychiatrischen Dienst bewährt. Dies hat aber auch Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung der Berufe im sozialpsychiatrischen Feld. Der Trend aus Kostengründen auch geringer qualifizierte Mitarbeiter einzustellen sollte deshalb gestoppt werden. Eine verpflichtende sozialpsychiatrisch-psychotherapeutische Weiterbildung (mit einem subjektoriententen/systemischen Schwerpunkt) für alle Berufsgruppen in der (Sozial-)Psychiatrie ist dringend notwendig, dann können auch die zu Recht genannten Syntheseaufgaben im 4.Kapitel „Verstehensbegleitung/Beziehungsarbeit und Anstöße zur Lösungsfindung/Veränderung“ gemeinsam mit den Betroffenen besser bewältigt werden. Die wichtigen genannten idealtypischen Stationen des Hilfebedarfs im Schlusskapitel benötigen aber noch viel gemeinsames politisches Vorgehen von Betroffenen, Angehörigen und Professionellen. Gerade die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise bietet hierzu die Gelegenheit die Frage zu stellen, ob und wie wir Solidarisch Mensch werden wollen – auch in der Psychiatrie. Gerhard Dieter Ruf: Erfreulicherweise gewinnen systemische Ideen in der Sozialen Arbeit in sozialpsychiatrischen Kontexten zunehmend an Bedeutung. Ein Werk wie das vorliegende, das aus einem systemischen Blickwinkel einen umfassenden Überblick über sozialpsychiatrische Konzepte und Methoden bietet, ist längst fällig. Frau Haselmann setzt damit ein Gegengewicht gegen die boomende biologische Psychiatrie und zeichnet ein Menschenbild, das nicht auf Gene und Neurotransmitter reduziert wird. Sie beschreibt den Klienten als eine in das Umfeld eingebundene Person, die Wert legt auf Sinnsuche und Verstehen der psychischen Störung. Sie führt damit einerseits die auf Verstehen und Begegnung ausgerichtete sozialpsychiatrische Tradition Dörners, die subjektorientierte Sozialpsychiatrie, fort. Andererseits baut sie mit der Betrachtung der sozialen Funktion psychiatrischer Symptome auf systemische Konzepte auf, wie sie in Deutschland vor allem von der Heidelberger Gruppe um Stierlin entwickelt wurden. Die Dialektik dieser beiden Wurzeln schlägt sich im Fragezeichen des Buchtitels nieder - ungewöhnlich für ein Lehrbuch - und mündet am Schluss des Buchs in die Synthese, die die Autorin metaphorisch mit der bekannten Kippfigur der sich begegnenden Gesichter bzw. der Vase darstellt. Sigrid Haselmann geht auf die verschiedenen, für die psychosoziale Arbeit im Psychiatriebereich relevanten Perspektiven in vier klar strukturierten Kapiteln ein. Das erste Kapitel ist dem Arbeitsfeld „Soziale Psychiatrie“ gewidmet. Die hilfreiche Unterscheidung zwischen strukturellen Kontexten (Versorgungsstrukturen) und ideellen Kontexten (Konzepte, Menschenbilder usw.) zieht sich durch das gesamte Buch. Bei dem „Helferdilemma“ als Grundproblem psychosozialer Versorgung sieht die Autorin eine systemische Lösung als Ausweg. „Der sozialpsychiatrische Versuch, gewissermaßen fürsorgliche Hilfe zur Autonomieentwicklung leisten zu wollen, erscheint aus systemischer Sicht als Falle - sowohl für die psychosozialen Helferinnen als auch für die Betreuten“ (S. 82). Man kann aus systemischer Perspektive allerdings im Betreuungssystem ein Milieu gestalten, das dem Klienten Autonomie ermöglicht. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Perspektive der subjektorientierten Sozialpsychiatrie, „welche die Begegnung zwischen den Professionellen und den Psychose- und/oder Psychiatrieerfahrenen ins Zentrum der psychosozialen Arbeit stellt (...) und auf den Dialog zwischen grundsätzlich gleichwertigen Gesprächspartnerinnen setzt (...) sowie auf ein Zusammenhandeln mit den Klienten statt auf eine Behandlung von Patientinnen durch so genannte Experten“ (S. 14). Sigrid Haselmann beschreibt die gängigen Strömungen und Konzepte der Sozialpsychiatrie: den Ansatz Luc Ciompis, Recovery, Empowerment, Salutogenese, Theorie sozialer Netzwerke, Psychoedukation und Selbstsorge nach Foucault. Bezüglich der konkreten Vorgehensweisen erörtert sie den Begegnungsansatz nach Dörner und Plog, die Leitprinzipien psychosozialer Arbeit in der Psychiatrie nach Mosher und Burti, die Grundregeln des Handelns in der Sozialpsychiatrie nach Ciompi und die Psychosentherapie nach Bock und Knuf. Arbeitsmethoden bei Notfällen und Krisen sowie bei akuten Psychosen und Tätigkeiten im Rahmen von Trialogen, Psychoseseminaren und Angehörigenarbeit werden anschaulich und nachvollziehbar vermittelt und mit Fallbeispielen illustriert. Die Autorin sieht das Verdienst der subjektorientierten Sozialpsychiatrie in einem menschlicheren Umgang mit den Psychoseerfahrenen oder Psychiatriebetroffenen und in der Förderung von Selbsthilfekräften und Selbstbestimmungsmöglichkeiten, verbunden aber mit dem Risiko, „dass die Sozial-/ Gemeindepsychiatrie unter Umständen zur Chronifizierung der Betroffenen mit beiträgt“ (S. 187), weil die Zuschreibung einer Krankheitsdiagnose und die Verantwortungsübernahme des medizinischen Systems die Familie von Verantwortung entlastet und zudem die gemeindepsychiatrischen Einrichtungen ihre Bemühungen nicht auf Heilung oder Behandlung ausrichten, „sondern darauf, den Betroffenen (und ihren Familien) ein ‚Leben mit der Krankheit‘ zu ermöglichen“ (S. 189). Im Kontrast zu dieser Subjektorientierung wird im dritten Kapitel ausführlich die ressourcenorientierte systemische Perspektive behandelt mit Sichtweisen, die „Störungen als Beschreibungen von Interaktionsprozessen betrachten und dabei berücksichtigen, dass diese Beschreibungen nicht von einer objektiven Warte her erfolgen können, sondern immer nur aus der Sicht eines Beobachters“ (S. 205). Die Kybernetik und das Autopoiese-Konzept als systemische Grundlagen werden ebenso anschaulich dargelegt wie die darauf aufbauenden verschiedenen Methoden, wie z.B. die lösungsorientierte Kurztherapie, das Externalisierungskonzept und das reflektierende Team, sowie die systemischen Grundprinzipien Neutralität, Ressourcenorientierung, Lösungsorientierung und Kundenorientierung. Die vorgenommene Einteilung der Handlungsfelder erscheint zur Kontextklärung sehr hilfreich. Unter Bezugnahme auf Definitionen von Ludewig unterscheidet Sigrid Haselmann zwischen einerseits Hilfe (als einer Reaktion auf eine Bitte um Hilfe) und andererseits Fürsorge (infolge einer Anordnung durch Dritte, etwa eine soziale Instanz). Sie differenziert zwischen systemischer Therapie und Beratung und den nicht systemisch ausgerichteten Hilfeformen Begleitung und Anleitung. Die schon durch das Fragezeichen im Buchtitel eingeführte thematische Spannung zwischen subjektorientiertem oder systemischem Vorgehen wird im vierten Kapitel behandelt. Es werden Indikationen für die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen herausgearbeitet. „Wenn Entscheidungen anstehen, Ziele erreicht werden wollen, Lösungen gefunden werden müssen, wird den jeweiligen Klienten mit einem systemisch-lösungsorientierten Ansatz besser geholfen sein als mit einem subjektorientierten Ansatz. Wenn den Klientinnen aber eher daran gelegen ist, zu verstehen, wie sie dahin gelangt sind, wo sie jetzt gerade stehen, (...) dann werden sie sich ein subjektorientiertes Vorgehen seitens der Professionellen wünschen“ (S. 359). Bei der konkreten Umsetzung könne es allerdings Schwierigkeiten geben, denn es stelle sich die Frage, „ob ein- und dieselbe Person (...) je nach Anliegen und Problemstellungen, mit ein- und demselben Klienten das eine Mal (...) subjektorientiert im Sinne einer Beziehungsarbeit vorgehen kann, ein anderes Mal jedoch systemisch beratend“ (S. 362). Verschiedene Lösungsmöglichkeiten werden vorgeschlagen, an erster Stelle die Zuordnung der verschiedenen Rollen zu unterschiedlichen Personen; dann kann eine Mitarbeiterin den systemischen Part vertreten, eine andere den subjektorientierten Part. Als idealtypisches Modell wird schließlich das skandinavische Modell der bedürfnisangepassten Behandlung der Psychosen vorgestellt. Als Voraussetzung für beide im Buch besprochenen Ansätze sei statt einer reinen Versorgungshaltung eine therapeutische Orientierung „im Prinzip von allen im Psychiatriebereich Tätigen zu fordern“ (S. 368). Die bekannte Kippfigur der Vase bzw. der beiden Gesichter beschließt das Buch als Symbol für die beiden Ansätze, die je nach Perspektive im Vordergrund erscheinen. Die Spannung zwischen subjektorientierter und systemischer Sichtweise, die sich durch das Buch zieht, spiegelt auch bekannte Kritikpunkte wider, die andernorts schon gegen beide Verfahren vorgebracht wurden: Das systemische Vorgehen vernachlässigt die Verstehensseite, das subjektorientierte Vorgehen die Möglichkeiten der Veränderung. Die Lösung der Autorin für diese Spannung besteht im alternierenden Einnehmen der beiden Positionen, symbolisiert mit der Kippfigur am Ende des Buches. Die damit verbundene Problematik für die persönliche Haltung des professionellen Helfers (s.o.) erscheint mir aber theoretisch nicht befriedigend gelöst. Denn wenn man wie zur Kippfigur verschiedene Perspektiven einnehmen kann, zeugt das von Konstrukt- und Methodenneutralität und ist per se eine systemische Haltung - ein Paradoxon? Ein weiteres Indiz für eine grundsätzlich systemische Haltung ist die von der Sigrid Haselmann vorausgesetzte Berücksichtigung von Auftragsklärung und Kontext und natürlich die implizite Kundenorientierung. Die Lösung des Paradoxons könnte auf einer Metaebene erfolgen: Eine systemische Metatheorie der Sozialen Arbeit, wie sie Wolf Ritscher angedacht hat, würde beides erlauben: Wohl wissend, dass Theorien nur Konstrukte sind und in Abhängigkeit von ihrer Nützlichkeit ausgetauscht werden können, könnte man je nach Bedarf daraus abgeleitete subjektorientierte oder systemische Methoden einsetzen. In diesem metatheoretischen Sinn denke ich, dass das vorliegende Werk eigentlich ein systemisches Buch ist und die mit Fragezeichen versehene Alternative des Titels dann entbehrlich sein könnte. Aber diese Anmerkung soll das Verdienst der Autorin nicht schmälern. Das Buch gefällt mir insgesamt sehr gut. Als Lehrbuch bietet es eine umfassende Einführung in den Arbeitsbereich mit vielen konkreten Anregungen und Fallbeispielen. In seiner ausführlichen und übersichtlichen Zusammenstellung sozialpsychiatrischer Konzepte und Methoden stellt das Werk einen wichtigen Meilenstein für die Soziale Arbeit in der Psychiatrie dar. Jeder, der in sozialpsychiatrischen Kontexten arbeitet, sollte es lesen. (mit freundlicher Genehmigung aus Kontext 2009) Zu einer weiteren ausführlichen Rezension von Reinhard Lütjen in socialnet.de Zur website von Sigrid Haselmann an der Hochschule Neubrandenburg Verlagsinformation: In diesem praxisorientiertem Handbuch wird mit Bezug auf die psychosoziale Arbeit im Arbeitsfeld Psychiatrie neben der subjektorientierten Sozialpsychiatrie die systemische Perspektive mit ihren anders gearteten Denk- und Vorgehensweisen vorgestellt. Beide Perspektiven grenzen sich auf je eigene Weise von klassisch-psychiatrischen Methoden der »Behandlung psychisch Kranker« ab. Welche Konzepte und Methoden sind einschlägig? Von welcher Art ist die jeweils angebotene professionelle Hilfe? Nach welchen Kriterien wird die Beziehung mit den Klienten gestaltet? Wie werden Gespräche geführt? Wie wird angesichts bestimmter Problemstellungen (z. B. Krisen, Chronizität) vorgegangen? Es zeigt sich, dass beide Ansätze – »Beziehungsarbeit und Verstehensbegleitung« und »Anstöße zur Lösungsfindung und Veränderung« – einander ergänzen und sich verbinden lassen. Das so geschaffene Sowohl-als-auch-Modell stellt einen hilfreichen Orientierungsrahmen für die psychiatrisch-psychosozialen Arbeit dar. Inhalt: Einleitung Einführung in die spezielle Thematik Einführung in das Buch als Lehrbuch 1 Das Arbeitsfeld »Soziale Psychiatrie« 1.1 Zwei Kontexte im Arbeitsfeld Soziale Psychiatrie 1.2 Was ist Soziale Psychiatrie? – Ideelle Kontexte 1.3 Was ist Soziale Psychiatrie? – Strukturelle Kontexte 1.4 Ideelle Milieus und Handlungspraxis 2 Die Perspektive der subjektorientierten Sozialpsychiatrie – Konzepte, Haltungen und Handlungsweisen 2.1 Grundlegende Orientierungen und Praxiskonzepte 2.2 Subjektorientierte psychiatrisch-psychosoziale Arbeit – Spezifische Herangehensweisen und Arbeitsformen 2.3 Verstehenszugänge zu Psychose-Inhalten 2.4 Fallstricke subjektorientierten sozialpsychiatrischen Arbeitens und Überleitung zur systemischen Perspektive 3 Die systemische Perspektive – Denk- und Handlungsmodelle für Therapie, Beratung und psychosoziale Arbeit 3.1 Einführung in die systemtheoretische Perspektive 3.2 Entwicklungslinie systemischer Therapiekonzepte: Drei Denkmodelle 3.3 Leitideen und Konzepte systemisch-konstruktivistischer Therapie 3.4 Haltungen, Methoden, Frageformen systemischer Therapie/Beratung 3.5 »Systemische Sozialarbeit« – Ein Exkurs 3.6. Sprachphilosophie und Postmoderne – Die narrativen Ansätze 3.7 »Systemische Psychiatrie« 3.8 Kritische Würdigung der systemischen Perspektive – Wertschätzung, einige Bedenken und offene Fragen 4 Psychosoziale Arbeit in der Sozialen Psychiatrie: Subjektorientiert oder systemisch vorgehen? 4.1 Drei Paradigmen in der psychiatrisch-psychosozialen Praxis 4.2 Subjektorientierte Sozialpsychiatrie oder systemischer Ansatz – Eine zusammenfassende Gegenüberstellung 4.3 Ein idealtypisches Modell der Verbindung systemischen und subjektorientierten Vorgehens Nachbemerkung Literatur Stichwortverzeichnis Über die Autorin: Dr. phil. Sigrid Haselmann, Diplom-Psychologin, ist Professorin für Psychologie an der Hochschule Neubrandenburg (FH), Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung. |
||||
|
|||||
|
Besuche seit dem 27.1.2005: 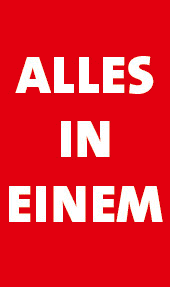  |

