 |
|
| Druckversion |
|
|
| Neuvorstellung | zur Übersicht |
|
07.07.2005 Hans-Joachim Giegel, Uwe Schimank (Hrsg.): Beobachter der Moderne. Beiträge zu Niklas Luhmanns "Die Gesellschaft der Gesellschaft" |
|
| Suhrkamp Verlag Tom Levold, Köln: 1997, ein Jahr vor seinem Tode, erschien das zweibändige Hauptwerk von Niklas Luhmann: "Die Gesellschaft der Gesellschaft". Wie wohl sonst nur das Buch "Soziale Systeme" von 1984 (das Luhmann im Vorwort seines Doppelbandes als "Einleitungskapitel" bezeichnet) ragt es aus seinen zahllosen Veröffentlichungen hervor und erscheint angesichts seines Todes im Jahre 1998 geradezu als Abschluss seines Werkes, ohne dass dies in der Absicht des notorisch produktiven Verfassers gelegen haben dürfte. Nun steht dieses gewaltige Werk zur Diskussion, Interpretation, Affirmation und Kritik - eine Aufgabe, die noch lange nicht abgeschlossen sein dürfte. Die Rezeption - nicht selten auch: Nicht-Rezeption – seines universaltheoretischen Ansatzes in den unterschiedlichen Fachdisziplinen ist bereits Gegenstand einer weiteren (Doppel-)Besprechung im systemagazin. Im vorliegenden Sammelband geht es nun um eine genuin sozialwissenschaftliche Diskussion des Luhmannschen "Opus Magnum". Der Großteil der Beiträge besteht aus ausgearbeiteten Vorträgen einer Tagung der Sektion „Soziologische Theorien“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, die zu Luhmanns Hauptwerk abgehalten wurde. Die Herausgeber Hans-Joachim Giegel und Uwe Schimank, Soziologie-Professoren an der Universität Jena und der Fern-Universität Hagen, legen einen Band vor, der Luhmanns "Nachdenken über die Beschaffenheit und die Perspektiven der heutigen Gesellschaft" reflektiert und dabei im Großen und Ganzen der Gliederung der „Gesellschaft der Gesellschaft“ folgt, indem er die Beiträge in die Abschnitte Kommunikationstheorie (Sozialdimension), Evolutionstheorie (Zeitdimension) und Differenzierungstheorie (Sachdimension) sowie „Gesellschaftliche Selbstbeschreibung“ gliedert. Dabei orientieren sie sich in der Auswahl der Autoren an einer Position „mittlerer Distanz“ zu Luhmann, d.h. weder affirmative Luhmann-Apologeten noch Frontalkritiker sollen zu Wort kommen, stattdessen kritische Sympathisanten sowie sympathisierende Kritiker (S. 8), so dass zumindest sprachliche Anschlussfähigkeit zwischen den einzelnen Beiträgen gewährleistet ist. Die Argumentation dieser Beiträge kann an dieser Stelle nicht ausführlich wiedergegeben werden. Das Abstraktionsniveau ist durchgehend hoch, schließlich geht es um die theoretische, gelegentlich auch empirische Testung der Luhmannschen Begriffe und Konzepte. Un kritisch ist es unbedingt, und zwar umso mehr, je mehr es sich von den allgemeintheoretischen Grundlagen Luhmanns entfernt und sich den empirischen Fragestellungen der Gesellschaftsanalyse zuwendet. Das Buch ist also keinesfalls als „Einführung in die Theorie der Gesellschaft“ gedacht, dafür sollte man sich seit 2005 besser an Luhmann selbst halten (vgl. die Rezension in systemagazin). Aus diesem Grund möchte ich nur einige wenige von vielen bedeutsamen Aspekten herausgreifen und folge dabei der inhaltlichen Aufteilung des Bandes. Die Abteilung „Kommunikationstheorie“ wird von Armin Nassehi, Wolfgang Ludwig Schneider und Rainer Greshoff behandelt (s. Inhaltsverzeichnis). Im Zentrum steht dabei die viel diskutierte Frage nach den Vorteil des Kommunikationsbegriffs gegenüber dem Handlungsbegriff für ein Verständnis sozialer Systeme. Nassehi, der seinen Beitrag mit einer Rekonstruktion der theoretischen Anleihen Luhmanns bei Edmund Husserl beginnt, betont, dass Handlungen ausschließlich das „Ergebnis von sozialen Zurechnungsprozessen“ sind, „d.h. Kommunikationssysteme behandeln sich selbst so, als seien sie Handlungssysteme, indem sie alles, was geschieht, auf Akteure zurechnen“ (28). Dabei sind Akteure selbst auch nur Konstruktionen und daher von „leibhaftigen Menschen“ zu unterscheiden, die - bekanntermaßen - für Luhmann als soziologische Kategorien uninteressant waren. Allerdings: „Wenn man also den Akteur für eine soziale Konstruktion hält, dann entwertet das nicht den Menschen, im Gegenteil. Akteure (Luhmann schlägt auch den Begriff der ‚Person‘ vor), Akteure sind Menschen, wie sie als Zurechnungspunkte in der Kommunikation vorkommen, wie sie von der Kommunikation als Handelnde behandelt werden. … Der Clou ist der, wie das wechselseitige Kontrollverhältnis läuft, wie also der Akteur, der zugleich als Effekt und als Irritation in das Kommunikations- und Handlungsgeschehen eingelassen ist, zugleich Kontrolleur und Kontrollierter ist“ (31). Wie noch zu sehen sein wird, beantworten die sympathisierenden Kritiker diese Frage genau andersherum (etwa Schimank, s.u.). Wolfgang Ludwig Schneider (auch ein kritischer Sympathisant) zeichnet die systemtheoretische Transformation des Handlungskonzeptes nach: „Sie ersetzt subjektiven Sinn durch kommunikativ zugeschriebenen Sinn, Motive durch erwartbare und semantisch vordefinierte Motivzuschreibungen, und sie verlagert den Schwerpunkt der Erklärung sozialen Wandels von der Ebene der Semantik und der semantischen Motivvokabulare auf die Ebene der sozialstrukturell erzeugten Änderung typischer Situationen und damit verknüpfter Opportunitäten“ (68). Mit Rainer Greshoff kommt ein „sympathisierender Kritiker“ zu Wort, der sich kritisch mit der Frage befasst, auf welche Weise Verstehen in der Kommunikation (wie Luhmann behauptet) als etwas Nicht-Psychisches gedacht werden könne und stellt dagegen, dass Kommunikation/Gesellschaft keine operationsfähige Instanz sei, die „Verstehen selbst beschaffen“ könne (Luhmann), dies könnten „allein die Instanzen Alter und Ego, die mit dem von ihnen hergestellten operativen Zusammenspiel Kommunikation/Gesellschaft im Wesentlichen ausmachen“ (80). Der Ausschluss des Psychischen aus der Kommunikation werde bei Luhmann nur aufgrund einer Verkürzung der Darstellung von Kommunikation auf Sprechen bzw. Geschriebenes plausibel, d.h. auf die sichtbare Seite kommunikativen Verhaltens. Greshoff setzt dagegen: „1) Kommunikation geht nicht in Sprechen (im Sinne von Verhalten) auf; 2) alles das, was zu einer jeweiligen Kommunikation gehört und nicht Verhalten ist, ist Gedankliches“ (89). er argumentiert also gegen die Trennung von Sozialem und Psychischem bzw. Körperlichem, so wie Luhmann sie vorgenommen hat und schlägt vor, die Person als „Instanz, die aus sehr grundlegenden Einstellungen/Erwartungen - etwa: ‚obersten Werten‘ - besteht“, als Komponente sowohl „individueller“ als auch „sozialer Systeme“ zu betrachten, je nachdem, ob die Personen „mit sich beschäftigt“ sind oder Einstellungen und Erwartungen aufeinander richten (96f.) Der Abschnitt zur Luhmannschen Verwendung des Evolutionsbegriffs enthält Arbeiten von Michael Schmid, Max Miller und Wil Martens. Schmid beurteilt den Erklärungswert der Evolutionstheorie Luhmanns skeptisch, da er die „evolutionäre Relevanz einer akteurlosen Selbstläufigkeit von Kommunikation“ abstreitet, die er lieber „wie jedes andere Systemgeschehen als Resultat intentionalen Handelns“ modellieren möchte, um „auf diese Weise den Gang der gesellschaftlichen Evolution auch dann als Produkt entscheidungsfundierter Mechanismen zu verstehen“ (148). Zwar nimmt er Luhmann auch gegen Kritiker in Schutz, die ihm Empiriefeindlichkeit vorwerfen, aber auch er bemängelt, „dass Luhmann … Spezifikationen nur mit Hilfe von lockeren, unsystematischen Beispielen vornimmt, die zwar die ‚Plausibilität‘ des eingeführten Begriffsapparats belegen mögen, insoweit aber kaum als Tests verstanden werden können, als Luhmann aus ihnen nur selten unabhängig prüfbare Folgerungen ableitet bzw. deren empirische Prüfung nicht vorsieht“ (140). Max Miller weist in einem kurzen Beitrag auf den „eigentümlich resignativen Zug“ der Gesellschaftstheorie Luhmanns hin, der sich aus der Idee ergäbe, dass sozialer Wandel letztlich nicht absichtlich herbeigeführt werden könne, sondern einfach nur stattfinde, und plädiert für die Nutzung von Chancen von Planungs-, Institutionalisierungs- und Lernprozessen, die die „Normalisierung des Unwahrscheinlichen ermöglichen“ (165). Auch Wil Martens zeigt sich mit seinem Aufsatz über „Struktur, Semantik und Gedächtnis“ als Luhmann-Kritiker. Er hält ihm vor, das „Gedächtnis der Gesellschaft“ vor allem in der „gepflegten Semantik“ und den Selbstbeschreibungen der Gesellschaft zu suchen und macht den Vorschlag, soziales und semantisches (bzw. kulturelles) Gedächtnis zu unterscheiden: „Das soziale Gedächtnis besteht aus den wiederholten Beziehungen der Kommunikationen (einschließlich der sie beschreibenden, als Orientierungshilfe fungierenden Kommunikationen) und den damit zusammenhängenden ‚Imprägnierungen‘ des (kollektiven) Bewusstseins, die man sich als Modelle oder Schemata kommunikativer Zusammenhänge denken kann. Die Personen wissen, welche Kommunikationen zusammengehören, eventuell soziale Systeme bilden, und sie haben ein ‚Gefühl‘ dafür, welche Kommunikationen in diesen Zusammenhängen erwartet werden“ (193). Fügte man noch die körperliche Verankerung dieses Gedächtnisses hinzu, wäre damit auch ein Anschluss an das Habitus-Konzept Bourdieus möglich. Auch das Bewusstsein ist für Martens „eindeutig an der Verfertigung von Kommunikations- und Sinnstrukturen beteiligt“: diesen „begegnen wir zerschnipselt und verstreut in Handlungen und Kommunikationen, sie werden daraus schematisierend, synthetisierend und idealisierend ‚destilliert‘. das kann nur als ‚Aktivität des Bewusstseins verstanden werden“ (198). Besonders kritisch fallen die Beiträge zum Thema „Differenzierung“ aus. Wie schon in der Einleitung festgehalten wird, erteilt Luhmanns Theorie der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft in einzelne Funktionssysteme (Recht, Politik, Wirtschaft etc.), welche die früheren Differenzierungsformen der Vormoderne (z.B. segmentäre oder regionale Differenzierung) abgelöst habe, allen (modernen) Vorstellungen eine Absage, dass damit ein sozialer Fortschritt verbunden sei, etwa durch Spezialisierungsvorteile, die sich aus einer Arbeitsteilung der Funktionssysteme ergäben. Der damit verbundene Verzicht auf Redundanz sei vielmehr ausgesprochen riskant. Die Risiken dieser „Selbstgefährdung der modernen Gesellschaft“ sieht Luhmann einerseits in der „kumulativen Exklusion nennenswerter, vielleicht wachsender Bevölkerungsgruppen aus Teilsystemzugehörigkeiten“ einerseits, in der „Ausbeutung und Vernichtung der natürlichen Umwelt“ andererseits. Dem gegenüber widme sich „Luhmann dem Problem gesellschaftlicher Integration offensichtlich nur als Pflichtübung“ (16). Die Frage ist hier also, wie das gesellschaftliche Ganze intern zusammengehalten wird, wie das Verhältnis der Funktionssysteme zueinander verstanden werden kann. Aus dem Autopoiese-Postulat Luhmanns ergibt sich ja in gewisser Weise, dass die einzelnen Funktionssysteme autonom und füreinander „blind“ sind, da sie nur aufnehmen können, was sie auf Grund ihrer systemeigenen Beobachtungsschemata beobachten können. Von Arbeitsteilung kann da nicht die Rede sein. Johannes Berger setzt dementsprechend auch damit an, dass „Luhmanns autopoietische Reformulierung der Theorie eher zur weiteren Verwirrung beigetragen“ habe, da sie theoretische Inkonsistenzen in Kauf nehme (207). Nach einer kurzen Skizze der Theorie funktionaler Spezifizierung präsentiert er seine Einwände zu unterschiedlichen Teilen der Theorie. So findet er es „fraglich, ob die Funktionsbereiche der modernen Gesellschaft durch Kommunikationsmedien charakterisierbar sind, die allesamt älter sind als die Moderne. Gibt es wirklich genau vier Medien und, wenn dies zutrifft - woran Luhmann (in der ‚Gesellschaft der Gesellschaft‘, S. 336, TL.) ja festhält -, wie kann es dann mehr als vier Funktionssysteme geben? (215). Eine weitere Kritik liegt darin, dass „Luhmann wissenssoziologisch Funktionssysteme primär durch Sichtweisen charakterisiert“ (219), woraus sich ergäbe, dass diese keine „Sichtweisen der Welt“ hätten, sondern selbst nur „Beobachtungsverhältnisse“ seien. Bergers eigene Entscheidung ist dabei eindeutig: er will nicht nur der Frage nachgehen, wie bestimmte soziale Systeme die Welt sehen, sondern darüber hinaus selbst Überlegungen anstellen, wie die diese Welt beschaffen ist: „Es ist einfach etwas anderes, Einkommensunterschiede selbst zu studieren oder lediglich die Fixierung auf sie als die Realitätsauffassung z.B. einer Linkspartei oder der Gewerkschaften zu thematisieren“ (221). Allerdings wirft er Luhmann auch vor, die Hinwendung zu einer rein semantischen Analyse von Sichtweisen nicht radikal genug betrieben zu haben, also die ältere Vorstellungswelt, dass man tatsächlich Aussagen über die Funktion von Teilsystemen für die ganze Gesellschaft treffen könne, nicht konsequenter preiszugeben (ebd.). Weitere Einwände betreffen die Konzeption der Funktionssysteme als autonome, gleichrangige, nur ihrer eigenen Autopoiese unterworfener Systeme. „Auf dem Boden dieser Konzeption sind artifizielle Begriffsmanöver erforderlich, um alltägliche Phänomene wie das Eindringen fremden Sinns in ein System, Sinnüberschneidungen und die Kommunikation zwischen Systemen in den Griff zu bekommen“ (222). Es sei vor diesem Hintergrund schwierig, aus der Position eines externen Beobachters überhaupt zu erkennen, wo die Grenzen eines Funktionssystems verlaufen (223). Zweitens könnten kommunikative Grenzziehungen soziale Grenzziehungen nur unzureichend abbilden (224) und drittens vergebe sich die Systemtheorie „mit dem Insistieren auf der operativen Geschlossenheit sozialer Systeme … die Möglichkeit, für das ubiquitäre Phänomen des Imports fremden Sinns eine geeignete Begrifflichkeit zu entwickeln“ (224). Ganz allgemein wird der m.E. berechtigte Vorwurf erhoben, dass mit dem „cultural turn auch der Systemtheorie … ein ‚herber‘ Themenverlust“ einhergehe, Fragen, „die früher einmal im Zentrum des Fachs (Soziologie, T.L.) standen, werden überhaupt nicht mehr aufgegriffen“, z.B. die Frage nach den Ursachen wirtschaftlichen Wachstums etc. (226f.). Als Folgerung aus dieser Argumentation empfiehlt Berger, wieder den „Weg zurück zu Parsons und Weber zu gehen“, nicht weil deren Ansatz weniger Probleme aufweise, sondern weil „in einem ‚institutionellen‘ Bezugsrahmen Fragen nach der Struktur und Entwicklung moderner Gesellschaften besser behandelt werden als in einem ‚autopoietischen‘“ (228). Diese grundlegende Kritik wird von Thomas Schwinn noch verstärkt, der das Problem der sozialen Integration von Gesellschaft in den Mittelpunkt seines Beitrages rückt, die nicht vom Luhmannschen Begriffspaar Inklusion/Exklusion abgedeckt werde, da diese „die soziale Integration eins zu eins an die Differenzierung der Ordnungen“ binde, womit „das Prinzip funktionaler Differenzierung als die unabhängige und soziale Integration als die abhängige Variable begriffen“ werde (233). Die Integrationskraft von Gesellschaften habe aber weniger mit den Funktionsleistungen einzelner Teilsysteme zu tun, sondern vielmehr mit ihrer Fähigkeit, Antworten für die heterogenen und milieuspezifischen, lebenspraktischen Probleme der Menschen zu bieten, die sich in ihrer eigenen Perspektive nicht auf „ausschnitthafte Partizipation an und in den einzelnen Ordnungen“ der Funktionssysteme reduzieren lassen. Schwinn macht hier geltend, dass die gegenwärtige soziale Integration „gegen das politische Regime und gegen die kapitalistischen Marktprinzipien durchgesetzt werden“ musste, d.h. ein „Ergebnis konflikthafter Auseinandersetzungen zwischen privilegierten (inkludierten) und unterprivilegierten (exkludierten) Gruppen und nicht bloß aus einer ordnungsspezifischen Differenzierungslogik erklärbar“ sei (236f.) In der Lebenspraxis der Individuen treffen sich „ordnungs- und lebenslaufintegrative Anforderungen“ (252) und „die Leistungssteigerung der differenzierten Ordnungen ist nur möglich, wenn die Leistungs- und Integrationsfähigkeit auf der Lebensführungsebene mitwächst“ (253). Auch wenn die Wortwahl ein wenig an die Habermas'sche Gegenüberstellung von Lebenswelt und System erinnern mag, geht es hier doch in erster Linie darum, ob „die Ordnungs- und Strukturanforderungen individueller Lebensführungen“ zur Umwelt von Gesellschaft gehören oder nicht, und ob normative Gesichtspunkte nicht auch für eine Systemtheorie der Gesellschaft eine Rolle spielen können: „Die differenzierten Ordnungen, insbesondere die Marktökonomie, sind blind für lebenslaufrelevante Belange. So ist eine prosperierende Wirtschaft mit gleichzeitig steigenden Arbeitslosenzahlen vereinbar. Verbot von Kinderarbeit, Schulpflicht, Arbeitszeitregelungen, Lohnhöhe, Arbeitslosengeld, Rentenhöhe und -alter, Mutterschaftsschutz etc., die Bedingungen, zu denen die Individuen in und an den Institutionen partizipieren und die die Eckdaten ihrer Lebensläufe markieren, sind nicht aus den differenzierten Institutionen einfach ableitbar, sondern mussten und müssen nicht selten gegen sie durchgesetzt werden. … Hier ergibt sich ein sozialer Regelungsbedarf, der nicht aus dem Differenzierungsprinzip ableitbar ist, sondern einer anderen, normativen Grammatik gehorcht“ (255). Auch der dritte Beitrag in dieser Abteilung von Mitherausgeber Uwe Schimank setzt auf ein „Umschwenken auf eine akteurtheoretische Perspektive“ (261), denn eine „akteurlose Sozialität“ sei nur eine Fiktion, als die das teilsystemische Geschehen den Akteuren selbst erscheine, und zwar in einer zirkulären Kausalschleife: „Weil die Akteure ihrem Handeln die Teilsysteme als Fiktionen zugrunde legen, kann das teilsystemische Geschehen weithin als Fiktion akteurloser Sozialität ablaufen, was wiederum auf Seiten der Akteure die Funktionen der Teilsysteme bestärkt usw.“ (270). Schimank kritisiert weiterhin - ähnlich wie schon Berger - den Begriff der „Funktionalen Differenzierung“, da sich für Luhmann eben nicht wie bei Parsons die „Differenzierung der Teilsysteme nach Funktionserfordernissen der Gesellschaft richtet“ (271), sondern ausschließlich nach den Differenzschemata, die durch den jeweilig vorgegebenen Code strukturiert werden. Damit fallen aber für Schimank die Möglichkeiten einer Untersuchung konkreter Strukturdynamiken aus der Beobachtung der Teilsysteme heraus, die nur durch eine Analyse des strategischen Handelns von Akteuren in unterschiedlichen sozialen Konstellationen zu erschließen seien (286). Dafür interessiere sich Luhmann aber zu wenig, und was er selbst als Beispiele für seine Gesellschaftstheorie heranziehe, ginge sowohl historisch als auch geografisch „drunter und drüber“, als gäbe es zwischen dem Unterschied zwischen Moderne und Vormoderne nicht auch noch erhebliche Unterschiede innerhalb der modernen Gesellschaft selbst (275). Bei allem Respekt gegenüber Luhmanns Leistung einer „Charakterisierung der modernen Gesellschaft als eines polykontexturalen Verdinglichungszusammenhangs“ schließt Schimank: „Um teilsystemische Strukturdynamiken ‚mittlerer Reichweite‘ beschreiben und erklären zu können, kommt man um Akteure und den ‚Gebildecharakter‘ der Teilsysteme nicht herum“ (294). Im letzten Beitrag des Bandes zum Thema der Selbstbeschreibung von Gesellschaft postuliert Georg Kneer, dass Luhmann entgegen seiner Kritik an der modernisierungstheoretischen Perspektive diese implizit selbst in Anspruch nimmt: „Wenn es am Ende von ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft‘ heißt, dass die moderne Gesellschaft in einer bestimmten Hinsicht erst am Anfang steht, so ist m.E. damit gemeint, dass gegenwärtig erst begonnen wird, den semantischen Apparat der Gesellschaft auf die Form einer reflexiven Beobachtung zweiter Ordnung umzustellen. … Luhmann beansprucht für seine eigenen Theoriekonstruktionen also genau das, was er anderen Semantiken, nicht zuletzt konkurrierenden soziologischen Theorieangeboten, abspricht: Modernität“ (329f.). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Band alles andere als leichte Kost darstellt. Er rückt gleichwohl Luhmanns Postulat in den Vordergrund, dass alle seine Beobachtungen und Theorie-Entscheidungen notwendigerweise kontingent sind, d.h. auch jeweils anders ausfallen könnten - und dann eben andere Beobachtungen und Theorie-Entscheidungen ermöglichen würden. Wer sich intensiver mit Luhmann auseinandersetzen will - und sich nicht ganz dem Plausibilitätserleben der Luhmann-Lektüre alleine überlassen möchte -, kommt daher um die Reflexion der Kontingenz seiner Theorieanlage und die Zur-Kenntnisnahme möglicher Alternativen nicht herum. Dieses Buch bietet den soziologisch interessierten und bewanderten Lesern eine Fülle kritisch-sympathisierender Hinweise zur eigenen Beschäftigung mit Luhmanns Gesellschaftstheorie. Einsteiger dürften sich dagegen etwas verloren fühlen. Der Band wird mit einer von Uwe Schimank erstellten Auswahlbibliographie von Niklas Luhmanns umfangreichen eigenen gesellschaftstheoretischen Arbeiten sowie neueren Beiträgen zu seiner Gesellschaftstheorie abgeschlossen. Die Website von Uwe Schimank finden Sie hier. Verlagsinfo: "Verlagsinformation: "Im Jahr 1997 erschien "Die Gesellschaft der Gesellschaft", das gesellschaftstheoretische Hauptwerk von Niklas Luhmann. Die darin entfaltete systemtheoretische Perspektive mit ihrer Grundformel, dass Gesellschaft nicht ohne Kommunikation zu denken ist und Kommunikation nicht ohne Gesellschaft, hat seither nicht nur der Soziologie entscheidende Impulse gegeben. Die unterschiedlichen Aspekte von Kommunikation, Evolution, Differenzierung und Beobachtung, die Luhmann seiner Untersuchung abgewinnt, sowie seine Idee der Weltgesellschaft sind Gegenstand dieses Materialienbandes. Die Autoren bringen Luhmanns Gesellschaftstheorie kritisch mit anderen soziologischen Sichtweisen ins Gespräch und ihre Texte sind damit Zeugnis für die Aktualität und Kraft dieses Klassikers der modernen Soziologie". Inhaltsverzeichnis: Schimank, Uwe (2003): Einleitung. S. 7-18. Nassehi, Armin (2003): Die Differenz der Kommunikation und die Kommunikation der Differenz. Über die kommunikationstheoretischen Grundlagen von Luhmanns Gesellschaftstheorie. S. 21-41. Schneider, Wolfgang Ludwig (2003): Handlung - Motiv - Interesse - Situation. Zur Reformulierung und explanativen Bedeutung handlungstheoretischer Grundbegriffe in Luhmanns Systemtheorie. S. 42-70. Greshoff, Rainer (2003): Kommunikation als subjekthaftes Handlungsgeschehen - behindern "traditionelle" Konzepte eine "genaue begriffliche Bestimmung des Gegenstandes Gesellschaft"? S. 71-113. Schmid, Michael (2003): Evolution. Bemerkungen zu einer Theorie von Niklas Luhmann. S. 117-153. Miller, Max (2003): Evolution und Planung - einige kritische Anmerkungen zu Luhmanns Theorie soziokultureller Evolution. S. 154-166. Martens, Wil (2003): Struktur, Semantik und Gedächtnis. Vorbemerkungen zur Evolutionstheorie. S. 167-203. Berger, Johannes (2003): Neuerliche Anfragen an die Theorie der funktionalen Differenzierung. S. 207-230. Schwinn, Thomas (2003): Differenzierung und soziale Integration. Wider eine systemtheoretisch halbierte Soziologie. S. 231-260. Schimank, Uwe (2003): Theorie der modernen Gesellschaft nach Luhmann - eine Bilanz in Stichworten. S. 261-298. Kneer, Georg (2003): Reflexive Beobachtung zweiter Ordnung. Zur Modernisierung gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen. S. 301-332. Schimank, Uwe (2003): Auswahlbibliographie zu Niklas Luhmanns Gesellschaftstheorie. S. 333-341. |
|
|
|||||
|
Besuche seit dem 27.1.2005: 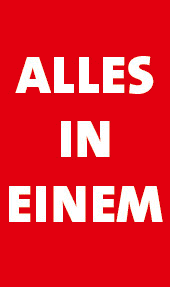  |
